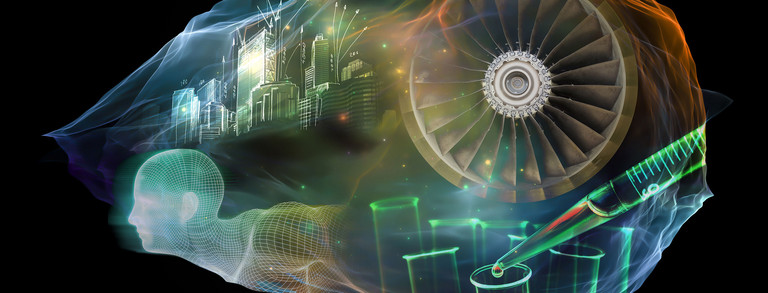Zwei Sonderforschungsbereiche an der TU Dortmund bewilligt
Prof. Ursula Gather, Rektorin der TU Dortmund, freut sich über diese Zusagen: „Dass beide Anträge erfolgreich waren, zeigt einmal mehr, wie forschungsstark und innovativ unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hier in Dortmund sind.“ Rund 16 Millionen Euro gehen innerhalb der nächsten vier Jahre an die TU Dortmund und erhöhen die wissenschaftliche Bedeutung der UA Ruhr.
SFB/Transregio 160 „Coherent manipulation of interacting spin excitations in tailored semiconductors“
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) wird in den kommenden vier Jahren den internationalen SFB/Transregio 160 „Coherent manipulation of interacting spin excitations in tailored semiconductors“ mit mehr als sieben Millionen Euro fördern. Sprecher ist Prof. Manfred Bayer vom Lehrstuhl Experimentelle Physik 2 der TU Dortmund.
Die Dortmunder Fakultät Physik kooperiert für das Forschungsprojekt mit dem russischen Ioffe Physical-Technical Institute und der St. Petersburg State University. Gemeinsam bilden die beteiligten Institutionen das International Collaborative Research Centre (ICRC). Die russische Seite wird durch die Russian Foundation of Basic Research mit etwa 50 Millionen Rubel unterstützt. Beteiligt ist auch jeweils eine Arbeitsgruppe von der Ruhr-Universität Bochum und der Universität Paderborn.
Die Forschungen beschäftigen sich mit dem Eigendrehimpuls von Elektronen in Halbleitern. Diese quantenmechanische Eigenschaft, der sogenannte Spin, beeinflusst die magnetischen Eigenschaften eines Materials und lässt sich durch ein Magnetfeld gezielt steuern. Aufgrund seines quantenmechanischen Charakters kann ein Elektron beliebige Orientierungen zwischen den extremalen Spin-Zuständen, „Up“ und „Down“, annehmen. Im Bereich der sogenannten Spintronik werden Spin-Effekte schon heute beispielsweise für Speichermedien genutzt.
Grundlagen für weitere Einsatzmöglichkeiten von Spin
Das internationale Team möchte Grundlagen erarbeiten, damit der Spin auch für darüber hinausgehende Funktionen eingesetzt werden kann, die mit bisherigen Techniken nicht realisierbar sind. In Halbleitern wäre etwa eine Spin-Anregung denkbar, die es nicht nur ermöglicht, Informationen zu speichern, sondern auch zu verarbeiten. Voraussetzung dafür sind neue ausgeklügelte Methoden, um die Spin-Anregung gezielt zu beeinflussen. Zudem müssen neue, verbesserte Materialien entwickelt werden.
Daran werden die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in den kommenden vier Jahren arbeiten. Dabei verfolgen sie den Ansatz, den Spin von interagierenden Elektronen kohärent zu kontrollieren. Außerdem werden sie neue Messtechniken entwickeln. Damit liefern sie einen wichtigen Beitrag für zukünftige Entwicklungen in der Informationstechnologie und bringen kohärente Spin-Effekte aus dem Labor in die Praxis.
SFB 876 „Verfügbarkeit von Information durch Analyse unter Ressourcenbeschränkung“
Die weltweite Datenmenge wächst unaufhaltsam und sprengt schon jetzt jede Vorstellungskraft. Im Sonderforschungsbereich 876 „Verfügbarkeit von Information durch Analyse unter Ressourcenbeschränkung“ erforschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der TU Dortmund neuen Methoden, mit denen diese Daten gesammelt, ausgewertet und genutzt werden können. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat die nun die Fortführung für weitere vier Jahre beschlossen und gibt rund neun Millionen Euro.
Ziel des Sonderforschungsbereiches (SFB) 876 ist es, aus riesigen Datenmengen nutzbare Informationen zu gewinnen, die unmittelbar vor Ort zur Verfügung stehen. Oft sind die Ressourcen an Rechen- und Kommunikationskapazität, Speicher und Energie jedoch begrenzt. Datenmassen in Größenordnungen von Petabyte (eine Million Gigabyte) sind zu umfangreich, um sie zunächst zu speichern und im Nachhinein in Ruhe zu analysieren. Stattdessen sind Systeme gefragt, die die Daten in Echtzeit filtern und analysieren. Daran arbeitet der SFB 876.
„Big Data” für Medizin, Astrophysik und Logistik
Die Auswertung von „Big Data“ spielt in vielen verschiedenen Bereichen eine Rolle: Der Medizin verhilft das „Next Generation Sequencing“, bei dem eine enorm große Anzahl an DNA-Abschnitten analysiert wird, beispielsweise zu genaueren Prognosen, wie sich ein Tumor (hier: das Neuroblastom) entwickelt und mit welcher Therapie er sich am besten bekämpfen lässt. In der Astrophysik lassen sich die umfangreichen Messergebnisse von Teleskopen wie „MAGIC“ oder „FACT“ auf La Palma sowie vom IceCube-Projekt analysieren, was zu neuen Erkenntnissen über den Kosmos führt. Die gigantischen Datenmassen aus Genf vom Large Hydron Collider werden im SFB 876 daraufhin untersucht, wie sie sich besser speichern lassen. Industrie 4.0, ein Zukunftsprojekt in der Hightech-Strategie der Bundesregierung, setzt feine Sensoren ein, die bereits während der Produktion Fehler erkennen und entsprechende Werkstücke augenblicklich aussortieren können. Die neu einbezogene Logistik erweitert die Plattform, die zur ressourceneffizienten Datenanalyse entwickelt wird.
Bereits in der ersten Förderperiode von 2011 bis 2014 beschäftigte sich der Sonderforschungsbereich damit, heterogene Datenströme so zu filtern, zu bereinigen und zusammenzufassen, dass sie mit vorhandenem Speicher und möglichst wenig Energie und Kommunikation auskommen und für die weitere Auswertung gut geeignet sind. Algorithmen für die Analyse sehr großer, dynamischer Datenmengen sind nach wie vor die wichtigste Herausforderung des SFB 876. Einerseits ermöglichen sie Prognosen für die Einsparung von Ressourcen, andererseits müssen sie selbst mit wenigen Ressourcen auskommen, so dass sie auch auf kleinen und mobilen Geräten ausführbar sind.
An den 14 Teilprojekten sind die Fakultäten Informatik, Statistik, Elektro- und Informationstechnik, Maschinenbau und Physik der TU Dortmund beteiligt, das Dortmunder Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften (ISAS), die Dortmunder Firma B&S Analytik sowie das Klinikum und die Verkehrsphysik des UA Ruhr Partners, der Universität Duisburg-Essen. Sprecherin des SFB 876 ist Prof. Katharina Morik vom Lehrstuhl für Künstliche Intelligenz der TU Dortmund.