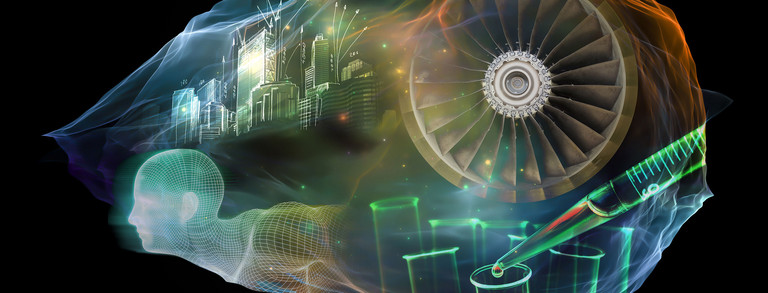Neue Konzepte zur Stärkung von Schulen
Auch die Schule hat Einfluss auf die Bildungschancen junger Menschen.
Unter der Leitung von Prof. Heinz Günter Holtappels (IFS) und Prof. Isabell van Ackeren (Uni Duisburg-Essen) werden Schulen der Sekundarstufe im Ruhrgebiet empirisch untersucht. Das Projektteam erfasst dabei sowohl äußere Einflussfaktoren – etwa Lernkompetenz, soziale Probleme oder die elterliche Unterstützung – als auch schul- und unterrichtsinterne Probleme, die die Bildungsziele und den Schulerfolg negativ beeinflussen.
Situation der Schulen wird analysiert
Ziel des Projekts ist es, die jeweiligen Bedingungskonstellationen aufzudecken und die Schulen daraufhin evidenzbasiert in ihrer Organisation und ihrem pädagogischen Potenzial zu stärken. Insbesondere belastete Schulen sollen damit extern bedingte und intern erzeugte Problemlagen besser bewältigen können.
„Gerade im Ruhrgebiet haben wir es in zahlreichen Regionen mit solchen Schulstandorten aufgrund der Schülerzusammensetzung und unzureichend wirksamer Problemlösungsansätze zu tun“, sagt IFS-Projektleiter Prof. Holtappels. „Deshalb wollen wir uns als Institut einer Universität im Ruhrgebiet im Sinne regionaler Verantwortung diesen Problemen widmen.“
In einem ersten Schritt werden Schulen dazu durch umfassende Erhebungen mit Blick auf ihre Problemsituation und die jeweils zugrundeliegenden Bedingungskonstellationen untersucht. Die Längsschnittuntersuchung beinhaltet Befragungen von allen beteiligten Ebenen: Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern sowie Schülerinnen und Schüler.
Individuelle Entwicklungsarbeit
Im Entwicklungsteil des Projekts werden auf der Basis der empirischen Analyse Module für die Schulentwicklungsarbeit – in Form von Fortbildungen, Trainings, pädagogischen Programmen oder Organisationsmaßnahmen – mit Fokus auf spezifische Problemlagen erarbeitet. Zugleich werden sechs bis acht Schulnetzwerke mit interessierten Schulen der Stichprobe gebildet, in denen neue wirksame Konzepte und Ansätze entwickelt werden. Die Beratungs-, Fortbildungs- und Unterstützungsmaßnahmen werden dann je nach Problemlage in den Schulnetzwerken oder mit einzelnen Schulen – in Kooperation mit Fortbildungspartnern und Qualitätsteams – durchgeführt. Nach den ersten Interventionen wird im dritten Projektjahr eine zweite Erhebung durchgeführt, um Entwicklungen abzubilden und erste Effekte der Interventionen zu überprüfen.