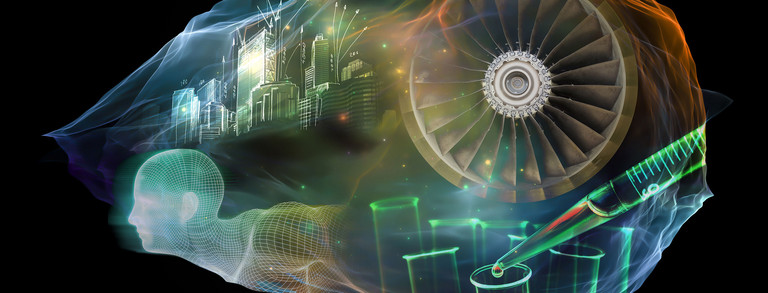Erstes Paper des Research Center One Health Ruhr
- UA Ruhr
- Forschung

Methan ist brennbar, farb- und geruchlos und unter anderem Bestandteil von Erdgas. Biologisch entsteht es etwa bei der Rinderhaltung, auf Reisfeldern oder beim Abbau organischer Materie. Das Erschreckende: Das Treibhausgas ist etwa 25-mal schädlicher als Kohlendioxid und beschleunigt den Klimawandel ungemein. Von 2020 bis 2021 stieg die Konzentration von Methan im jährlichen Durchschnitt weltweit stärker als in den Vorjahren.
Die Hauptquelle der biologischen Herstellung des Gases geht auf das Konto einzelliger Mikroorganismen (sogenannter Archaeen). Sie erzeugen für sich seit etwa 3,5 Mrd. Jahren Energie mit Kohlendioxid und Wasserstoff – und damit Methan. „Im Laufe der Erdgeschichte haben sich dann verschiedene Gruppen von Methanogenen entwickelt, die auch aus organischen Verbindungen wie Methanol Methan bilden konnten“, so Dr. Panagiotis Adam. Die Wissenschaft sei seit langem uneins, was die ursprüngliche Art der Methanproduktion war. „Aus den ursprünglichen Genen haben sich dann für die sogenannte Methanogenese andere Stoffwechselwege gebildet, die unter Ausschluss von Sauerstoff funktionieren. Damit sind die Gene zur Methanbildung der Ursprung vieler anderer Stoffwechsel auf Erden“, erklärt der Biologe.
Die UDE-Forscher haben mit den Athener Kollegen zudem zwei neue Gruppen kleiner Lebewesen mit Überresten der Methanogenese entdeckt und darüber publiziert. „Sie haben eine sehr große Anzahl von Restgenen behalten. Wir nennen sie ‚Mnemosynellales‘, nach Mnemosyne, der Göttin des Gedächtnisses. Und ‚Hecatellales‘ wie Hecate, die Göttin der Wegkreuzungen. Sie leben tief unter der Erde in geothermischen Umgebungen oder Erdölreservoirs“, so Adam. Er und der Forscher George Kolyfetis aus der UDE-Chemie sind Erstautoren der Studie. „Auch wenn sie selbst keine Methanogenese mehr betreiben, spielen sie trotzdem eine wesentliche Rolle im Kohlenstoffkreislauf ihres Ökosystems.“
** Adam, P./Kolyfetis, G.: Genomic remnants of ancestral methanogenesis and hydrogenotrophy in Archaea drive anaerobic carbon cycling., in: Science Advances 8(44), eabm9651), https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abm9651
Weitere Informationen:
Fakultät für Chemie:
Dr. Panagiotis Adam
Prof. Dr. Alexander Probst
Alexander.J.Probstprotonme